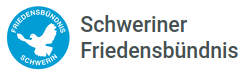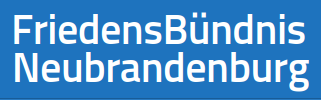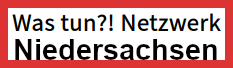"Öl-Raffinerie Schwedt: Wenn Russland-Sanktionen nicht Putin, sondern deutsche Arbeiter treffen." So der Titel eines Beitrags in der Berliner Zeitung vom 19.01.2025. Der Prozess des Abbaus der PCK wird in diesem Jahr nun eingeläutet, wenn die Beschäftigungsgarantie im Juni 2025 ausläuft. Die Bundesregierung hatte ihre Treuhandverwaltung der Mehrheitsanteile (54,17 Prozent) von Rosneft Deutschland im September letzten Jahres verlängert. Die PCK Schwedt bleibt vorerst unter der Kontrolle der Bundesnetzagentur. Die Raffinerie hat große Bedeutung, weil Ostdeutschland von der dortigen Treibstoff-Produktion in großen Teilen abhängig ist. Nach dem sanktionsbedingten Stopp russischer Ölimporte über die Druzhba-Pipeline (Grafik) kommt über diese Pipeline seit Februar 2023 nur noch Kasachisches Öl; 1,2 Millionen Tonnen im Jahr, bei einer Kapazität von zwei Millionen Tonnen. Ein Teil kommt nun auch von internationalen Märkten, angelandet in Rostock, wobei die Kapazität der alten (trotz Versprechen nicht ertüchtigten!) Pipeline von Rostock nach Schwedt begrenzt ist, sie hat nur 55 cm im Druchmesser. Ein neuer Eigner für die PCK Raffinerie wurde noch nicht gefunden. Die Unzufriedenheit unter breiten Kreisen der Belegschaft nimmt inzwischen zu.
Frank Bornschein - ein Mitinitiator der Friedensbewegung in Schwedt und Mitstreiter in unserem Friedensbündnis - kommt aus Schwedt/Oder und hat uns seine Einschätzung zur Vefügung gestellt:
Liebe Tagungsteilnehmer*, liebe Gäste,
Mein Name ist Frank Bornschein, ich bin 62 Jahre alt und komme aus Schwedt/Oder im Nordosten der Bundesrepublik Deutschland. Ich bin Mitinitiator der Friedensbewegung in Schwedt und der Initiative „Frieden, Freiheit und Souveränität“. Darüber hinaus bin ich im Gemeinderat und übe eine berufliche Tätigkeit als Unternehmensberater aus.
Zunächst möchte ich kurz den Begriff und die Bedeutung der Deindustrialisierung erläutern. Als Deindustrialisierung werden Prozesse des sozialen oder wirtschaftlichen Wandels bezeichnet, die durch einen Rückgang der Industriesektoren, insbesondere der Schwerindustrie und des verarbeitenden Gewerbes, in einem Land oder einer Region verursacht werden. Es liegt vor, wenn die Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe abnimmt und dadurch die Zahl der Arbeitsplätze in der Industrie abnimmt. Dies geht aus einer allgemein anerkannten Definition der Schweizerischen Akademie der Technischen Wissenschaften SATW hervor, die auch laufende Studien zu diesem und anderen damit zusammenhängenden Thema durchführt Themen. Um also von Deindustrialisierung zu sprechen, muss es über einen längeren Zeitraum weniger Wertschöpfung und weniger Arbeitsplätze geben.
Die Situation in Deutschland ist diesbezüglich sehr vielfältig, wo die Kernkompetenzen – also der Schwerpunkt der industriellen Produktion – von vier Branchen dominiert werden: der Automobilindustrie, der Maschinenbauindustrie, der chemischen Industrie und der Elektroindustrie. Energieintensive Industrien sind vor allem die chemische und metallurgische Industrie. Aber auch die Kohle- und Erdölverarbeitung sowie die Herstellung von Glas, Keramik, Papier und Pappe sind energieintensive Industriezweige. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verbrauchten diese Industrien im Jahr 2020 791 Milliarden kWh, also rund 76 % der gesamten in der Industrie verbrauchten Energiemenge, erwirtschafteten sie 21 % der Bruttowertschöpfung, Im Jahr 2020 waren rund 935.000 Beschäftigte in der diesen Industrien tätig; in den rund 7.000 Unternehmen sind rund 12 % aller Produktionsmitarbeiter beschäftigt.
Dies war die Ausgangssituation in Deutschland im Jahr 2020. Seitdem hat sich diese Situation jedoch immer weiterentwickelt.
Der EU Green Deal 2019, der den Empfehlungen des Club of Rome von 1972 (mit seiner Forderung, das Wachstum zu begrenzen) folgt, umfasst Prioritäten wie Finanzmarktregulierung, Energieversorgung, Verkehr, Handel, Industrie, Land- und Forstwirtschaft. In fast allen Schlüsselbereichen einer Volkswirtschaft muss gemäß diesem "Deal" der Wandel umgesetzt werden. Und der Begriff „Regulierung“ bedeutet lediglich Kapazitätsreduzierung und -beschränkungen. Diese Änderung wird politisch verschleiert und als geplante Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 55 % bis 2050 gegenüber dem Niveau von 1990 dargestellt, auf deren Grundlage am 30. Juni 2021 das europäische Klimagesetz verabschiedet wurde.
Mittlerweile kam es zum Abbau der Industrie. Derzeit gibt es rund 50.000 Beschäftigte in energieintensiven Industrien weniger als im Jahr 2020. Noch sind dort 880.000 Beschäftigte tätig, aber die Deindustrialisierung wurde eingeleitet. Wir können daher nicht von einer zufälligen Deindustrialisierung Deutschlands und Europas sprechen, sondern von einem Plan und einem politischen Willen. Branchen mit hohem Energieverbrauch wie die chemische und metallurgische Industrie, sowie die Verarbeitung von Kohle und Mineralölen sind zuerst betroffen, bevor benachbarte Branchen wie die Kohleversorgung und der Dienstleistungssektor betroffen sind.
Ich möchte nun das Beispiel der PCK Schwedt anführen.
Schwedt, eine Stadt mit aktuell rund 32.000 Einwohnern im Nordosten Deutschlands, ist seit 1965 ein wichtiger Chemie- und Industriestandort. Geprägt wird die Stadt durch zwei mittelständische Unternehmen der Ölverarbeitungs- und Papierherstellungsbranche, die jeweils mehr als 1200 Mitarbeiter beschäftigen, sowie durch rund 5000 weitere Beschäftigte in angrenzenden Branchen. Im Jahr 2020 erwirtschaftete Schwedt ein Drittel der gesamten Bruttowertschöpfung im Land Brandenburg und die höchste Pro-Kopf-Wertschöpfung der neuen Bundesländer. Außerdem habe ich selbst meinen ersten Beruf bei PCK erlernt. Bis Ende 2021, also vor der Verschärfung des Ukraine-Konflikts, wurden dort jährlich 11 Millionen Tonnen Rohöl verarbeitet, hauptsächlich aus Russland über die Druschba-Pipeline (Freundschaft).
Mit dem Ende des Bezugs von russischem Öl zum Jahreswechsel 2022/2023 wurde die PCK dann über die bestehende Pipeline aus dem Hafen Rostock versorgt, die jedoch nur über eine Kapazität von 6 Millionen Tonnen verfügt. Aufgrund dieses geringen Angebots können nur etwa 55 bis 60 % der maximalen Produktion sichergestellt werden, während die Gewinnschwelle bei etwa 70 % liegt. Selbst bei der geplanten Lieferung von 1,2 Millionen Tonnen kasachischem Öl kann der Break-Even-Punkt daher nur schrittweise erreicht werden, was bedeutet, dass die PCK selbst im besten Fall nur an der Grenze des Break-Even-Punkts operieren wird , was zumindest mittelfristig einen Kapazitätsabbau um etwa ein Drittel erforderlich macht und damit Arbeitskräfte freisetzt.
Das Vorgehen der Politiker zielt darauf ab, die Belegschaft zu besänftigen, zu beruhigen oder sogar zu täuschen, indem sie beispielsweise die Bildung einer sogenannten Arbeitsgruppe oder eines Umschulungsausschusses ankündigen. Dies alles funktionierte, zumindest teilweise, und hielt die Arbeitsmoral trotz der Unzufriedenheit hoch, indem man ihnen einfach nicht die Wahrheit sagte.
Tatsächlich sieht schon ein Grundsatzdokument des Bundeswirtschaftsministeriums aus dem Jahr 2019 eine drastische Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe auf 40 % bis 2030 und auf 10 % bis 2050 gegenüber dem Niveau von 2018 vor. Dieses Ziel ist auch im Koalitionsvertrag 2021 der Bundesregierung verankert und damit ein fester politischer Wille. Zu diesem Zeitpunkt war die Eskalation des Ukraine-Konflikts zwar noch nicht eingetreten, die Politiker nutzten sie jedoch zur Rechtfertigung ihres Handelns.
Den Mitarbeitern der PCK Raffinerie wurde eine Arbeitsplatzgarantie bis Ende 2024 und einem weiteren Jahr im Falle eines Verkaufs (gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bei Unternehmensübernahmen) zugesichert, was dazu geführt hat, dass die weitverbreitete Unzufriedenheit in der Belegschaft sich bisher nicht in großem Protest geäußert hat. Doch selbst wenn das Geschäft weiterhin ausgeglichen ist, werden im Zuge der Digitalisierung ganze manuelle Produktions- und Prüfketten wegfallen, sodass wahrscheinlich am Ende nur noch maximal 250 bis 300 Mitarbeiter bei PCK beschäftigt bleiben. Als Folge der Produktionsreduzierung ist es bisher noch nicht zu regionalen Engpässen in der Mineralölversorgung gekommen, was den Schluss zulässt, dass auch bei einer Produktionsreduzierung auf 30 % dies mit allen daraus resultierenden Konsequenzen gewährleistet ist. Ich möchte auch erwähnen, dass sich das zweitgrößte Unternehmen in Schwedt, das LEIPA Werk Schwedt (Papaierverarbeitung), derzeit auch in einer Sanierung in Verbindung mit einer erheblichen Restrukturierung befindet.
Im Rahmen unserer Initiative „Freunde des Friedens Schwedt e. V. sowie den “Schwedter Menschen miteinander füreinander" werden wir unsere Aktivitäten darauf ausrichten, über diese Entwicklung bzw. diese Projekte zu informieren und weiterhin dagegen zu protestieren. Dies geschieht durch Proteste, Mahnwachen und Veranstaltungen wie das für Ende August [2023] geplante Friedensfest, Autokorsos und die Vernetzung mit anderen Initiativgruppen aus benachbarten Städten und Landkreisen. Schließlich entwickeln wir Angebote für die Menschen selbst, um ihnen aufzuzeigen, wie sich die Situation in einer besseren Gesellschaft verbessern kann.
Wir sind davon überzeugt, dass wir dieser verheerenden Politik wirksam entgegenwirken können, und wünschen allen viel Kraft und Erfolg. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf. Vielen Dank.
* Frank Bornschein hat die Rede am 8./9. Juli 2023 in Strasbourg (Frankreich) auf der Konferenz des Schiller-Instituts: „Angesichts der Gefahr eines neuen Weltkriegs müssen die europäischen Länder mit dem globalen Süden zusammenarbeiten“ gehalten. Das Video der Rede ist hier abrufbar (mit französischer Simultanübersetzung)